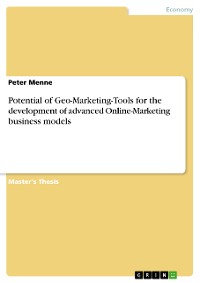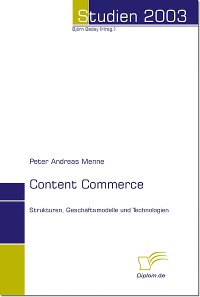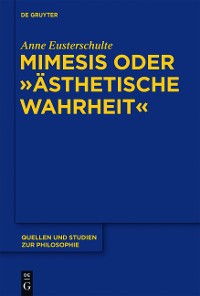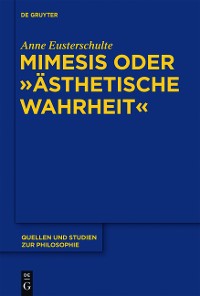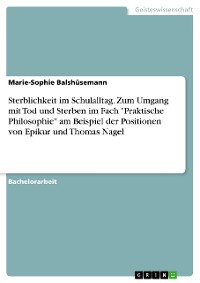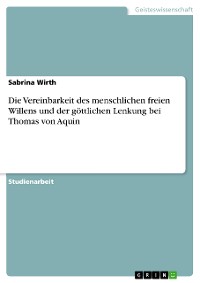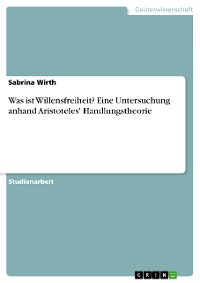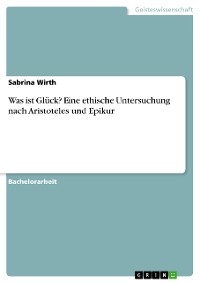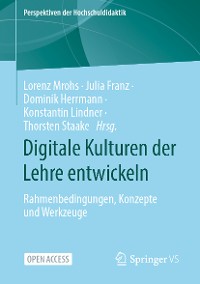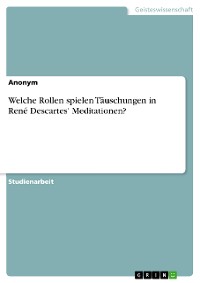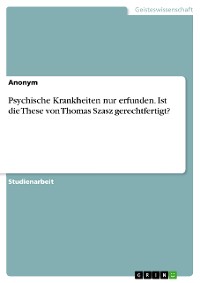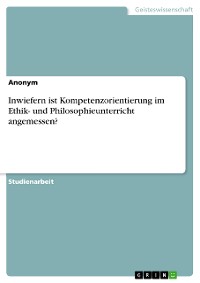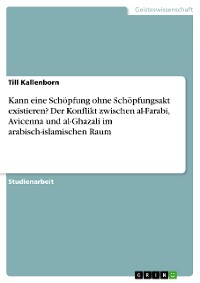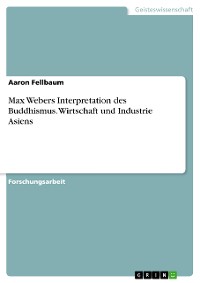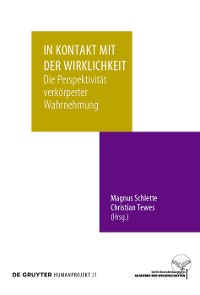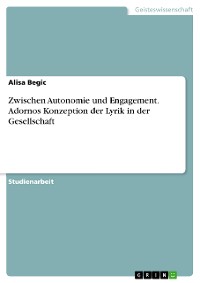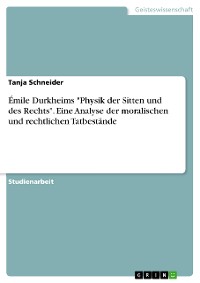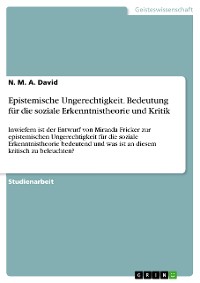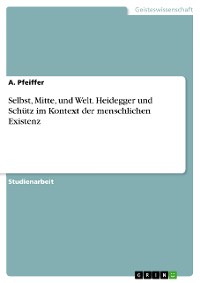Die Dramatisierung eines Romans. Eine vergleichende Untersuchung zu Gerhard Zwerenz: "Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond" und Rainer Werner Fassbinder: "Der Müll, die Stadt und der Tod".
Peter Menne
* Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Sonstiges
Beschreibung
Als das Schauspielhaus Frankfurt Fassbinders Drama "Der Müll, die Stadt und der Tod" 1985 uraufführen wollte, ereignete sich der größte Theaterskandal der BRD: Die Bühne wurde besetzt, die Uraufführung fand nicht statt. Wiederholt wurde behauptet, Fassbinders Drama wäre antisemitisch. Tatsächlich beschreibt es die Funktionsweise von Antisemitismus. Darin unterscheidet es sich fundamental von Gerhard Zwerenz' vorgängigem Roman "Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond", in dem antisemitische Klischees reichlich ausgebreitet werden. In welcher Beziehung stehen die beiden Texte (unterschiedlicher literarischer Gattung)? Der Autor klärt ihren Bezug zueinander, skizziert und interpretiert ihre Inhalte. Detailliert werden die jeweiligen Positionen zu drei Aspekten untersucht: 1. Welches Bild wird vom Wirtschaftssystem gezeichnet? 2. Welche Funktion hat die Beschreibung sexueller Aktivitäten? 3. Sind die Texte antisemitisch? Welche Funktion übernehmen die Judenfiguren bzw. der Reiche Jude? Menne weist grundverschiedene Positionen beider Texte zu den Fragen nach: 1. Marktwirtschaft: in Fassbinders Drama leiden alle unter der marktwirtschaftlichen Konkurrenz: das System wird als unmenschlich kritisiert. In Zwerenz' Roman treiben böse Menschen böse Dinge – kritisiert wird nur, dass der Markt manche Teilnehmer nicht bremst. 2. Sexualität: Käufliche Liebe dient im Drama als Modell für marktwirtschaftlichen Tausch. Dabei unterstreicht deren Erfolg bei gleichzeitigem Scheitern aller liebesorientierten Intimitäten die Kritik am Markt. Der Roman zeichnet patriarchal dominierten Sex als Erfolgsmodell. Beschreibungen von Intimitäten lockern die Kapitel auf, auch wenn sie in keinem Zusammenhang zur übrigen Handlung stehen. 3. Die Funktion der Judenfigur(en) ist entgegengesetzt: der "Reiche Jude" des Dramas fungiert als Projektionsfläche für alte und neue Nazis, ist selbst Sympathieträger. "Abraham" und die weiteren Juden des Romans hingegen verkörpern antisemitische Klischees.
Kundenbewertungen
Literaturwissenschaften Theaterwissenschaften Antisemitismusdiskurs Gentrifizierungsdiskurs